Gespenster sind langlebig
Der Spuk von Wildbad Kreuth ist wieder auferstanden. Von Georg Fülberth
Was ist ein Wildbad? Wikipedia belehrt uns: eine naturbelassene Badestelle. Acht oder neun deutsche Gemeinden tragen diese Bezeichnung im Namen. Hinzu kommt Wildbad Kreuth im oberbayerischen Landkreis Miesbach.
Dort betreibt die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung ein Bildungszentrum. Seit 1976 trifft sich dort jedes Jahr die Bundestags-Fraktionsgruppe mit dem Landesvorstand zu einer Klausurtagung. Schon beim ersten Mal wurde der Ort berühmt: Am 19. November wurde mit 30 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, einer Enthaltung und einem Ungültig beschlossen, die seit 1949 bestehende Fraktionsgemeinschaft mit der Schwesterpartei CDU aufzukündigen. Formal wurde dies so begründet: Man bekomme dann zweieinhalb Millionen D-Mark Fraktionszuschuss und mehr Redezeit.
Doch niemand glaubte, dass das alles war, am wenigsten die CDU. Zehn Tage später, am 29. November, stellte sie der CSU ein Ultimatum: Wenn sie ihren Beschluss nicht zurücknehme, werde man die Gründung eines eigenen bayerischen Landesverbandes vorbereiten. Logisch musste darauf folgen, dass die CSU dasselbe in den anderen Bundesländern tun werde. Damit gewannen die Spekulationen um eine »Vierte« - dezidiert konservative - Partei, die schon länger im Schwang waren, Auftrieb. Um diese Entwicklung zu verstehen, ist ein historischer Rückgriff vonnöten.
Als CDU und CSU aus der Bundesregierung ausschieden, war insbesondere die CDU organisatorisch schlecht darauf vorbereitet. Sie hatte nur einen schwachen Apparat. Unter den Vorsitzenden Adenauer, Erhard und Kiesinger war sie vom Kanzleramt aus geführt worden. Auch hatte sie keine sehr aktive Mitgliederwerbung betrieben. Es schien zu genügen, dass sie die wirtschaftlichen Eliten, den Staatsapparat auf Bundesebene, die katholische Kirche und einen Teil der evangelischen sowie viele alternde ehemalige Nazis hinter sich hatte. 1969 änderte sich an dieser Einstellung zunächst nichts: Man hoffte, schnell wieder in die Regierung zurückkehren zu können. Mit dem Scheitern des Misstrauensvotums gegen Willy Brandt und der Niederlage bei der Bundestagswahl 1972 erwies sich dies als Illusion. Der neue Bundesvorsitzende Helmut Kohl (seit 1973) und sein Generalsekretär Kurt Biedenkopf bauten die CDU von einer Regierungspartei im Wartestand zu einer »Apparat-Masse-Partei« um. Dieser Ausdruck stammt von dem bayerischen Politologen Alf Mintzel, der ihn aufgrund seiner Untersuchung einer anderen Partei geprägt hatte: der CSU. Als sie 1954 bis 1957 in Bayern drei Jahre in die Opposition musste, hatte sie daraus die Konsequenz gezogen, sich nicht allein auf ihre Regierungspräsenz verlassen, sondern eine schlagkräftige Organisation mit breiter Verankerung aufgebaut. Kohl und Biedenkopf versuchten dies nun nachzuholen.
Die Bundestagswahl 1976 haben CDU und CSU entweder gewonnen oder verloren, wie man’s nimmt. Gewonnen: Anders als 1969 und 1972 hatten sie wieder mehr Stimmen als die SPD. Die CSU erreichte mit 60 Prozent in Bayern und 10,6 Prozent im Bund ihr bisher bestes Ergebnis. Verloren: Da die Union keine absolute Mehrheit hatte, blieb sie in der Opposition. Langfristig erschien sich nur eine Chance zu ergeben, wenn es ihr gelang, die FDP aus der Bindung an die SPD wieder zu lösen. Jene war seit 1969 eine nicht nur wirtschafts-, sondern auch »sozialliberale« Partei mit Spürnase für moderne Trends: durch ihre Unterstützung der neuen Ostpolitik und von Infrastruktur- und Bildungsreformen. Bewegte sich die Union auf sie zu, um mit ihr koalitionsfähig zu werden - was geschah dann auf dem rechten Rand des Parteiensystems?
Hier sah Franz Josef Strauß, der CSU-Vorsitzende, eine Chance für sich: wenn es Platz für eine »Vierte Partei« gab. Außerhalb Bayerns hatten sich schon »CSU-Freundeskreise« gegründet. Strauß war ein strategischer Kopf, aber er wurde nie den Ruch los, zuerst an sich selbst zu denken. Immer wieder ließ er durchblicken, Helmut Kohl sei nur ein subalterner Kanzlerkandidat. Dies erklärt wohl zum Teil auch dessen schnelle und harte Reaktion auf Kreuth. Sein Ultimatum zeigte Wirkung: Strauß konnte ebenfalls rechnen. Breitete sich die CDU in Bayern aus, war es mit der Alleinherrschaft der CSU dort vorbei.
Am 12. Dezember 1976 wurde die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU erneuert. 1978 ließ sich Strauß zum bayerischen Ministerpräsidenten wählen. Damit schuf er sich eine Machtbasis jenseits von Bonn. 1976 hatte er nicht nur verloren. Nach wie vor hatte er Sympathisanten auch außerhalb Bayerns, zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo der ehemalige NS-Marinerichter Filbinger regierte, und in Hessen, wo Alfred Dregger, Anführer der »Stahlhelm-Fraktion« der CDU, die Landespartei auf strammen Rechtskurs brachte. 1980 wurde Strauß Kanzlerkandidat. Die breite Mobilisierung gegen ihn rettete wieder einmal die von der Fünf-Prozent-Hürde bedrohte FDP. Seine Niederlage war zugleich der unionsinterne Sieg Helmut Kohls, der 1982 Kanzler einer neuen Bürgerblock-Regierung wurde.
Nach Strauß’ Tod 1988 erlitt die CSU 1989 einen weiteren herben Schlag: Nicht sie war es, die sich nach dem Anschluss der DDR dorthin ausdehnte, sondern die CDU, als Helmut Kohl die ostdeutsche Christlich-Demokratische Union brüderlich an seine Brust zog. Von der alten - ohnehin eher fiktiven - Doppelstruktur der Union ist seitdem nicht mehr so arg viel übrig geblieben. Sie verdeckt das durch profilneurotische Strampelei.
Anders kann es mit den Chancen einer Partei rechts von ihr stehen. Dieses Projekt tauchte ja immer wieder einmal auf, zum Beispiel 1989 mit den »Republikanern«. Das Axiom des Franz Josef Strauß, rechts von der Union dürfe es niemals eine Parlamentsfraktion mit Massenbasis geben, mag ein rationaler Teil seines politischen Erbes sein. Damit verbunden ist die Gefahr, dass CDU und CSU ihr Monopol durch ungenierte Öffnung für demokratieferne Tendenzen zu sichern suchen.
Jedes Jahr wird mindestens einmal im Jahr der »Geist von Kreuth« beschworen. Gepenster sind langlebig. Immerhin wird ab 2016 die CSU-Landesgruppe nicht mehr in Kreuth tagen. Der Hanns-Seidel-Stiftung ist die Miete dort zu hoch geworden.
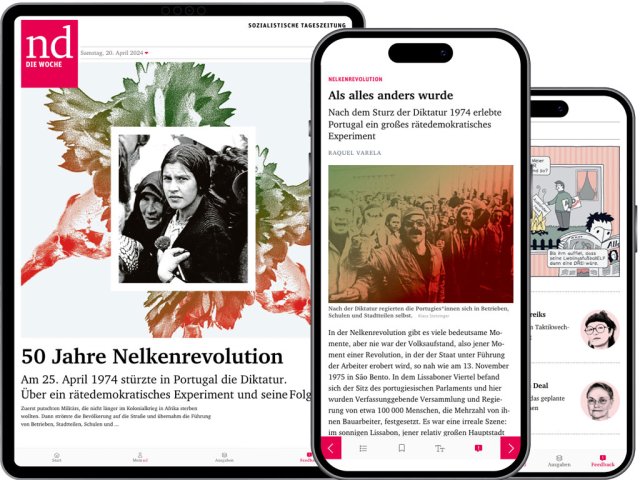
In der neuen App »nd.Digital« lesen Sie alle Ausgaben des »nd« ganz bequem online und offline. Die App ist frei von Werbung und ohne Tracking. Sie ist verfügbar für iOS (zum Download im Apple-Store), Android (zum Download im Google Play Store) und als Web-Version im Browser (zur Web-Version). Weitere Hinweise und FAQs auf dasnd.de/digital.
Linken, unabhängigen Journalismus stärken!
Mehr und mehr Menschen lesen digital und sehr gern kostenfrei. Wir stehen mit unserem freiwilligen Bezahlmodell dafür ein, dass uns auch diejenigen lesen können, deren Einkommen für ein Abonnement nicht ausreicht. Damit wir weiterhin Journalismus mit dem Anspruch machen können, marginalisierte Stimmen zu Wort kommen zu lassen, Themen zu recherchieren, die in den großen bürgerlichen Medien nicht vor- oder zu kurz kommen, und aktuelle Themen aus linker Perspektive zu beleuchten, brauchen wir eure Unterstützung.
Hilf mit bei einer solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl.

